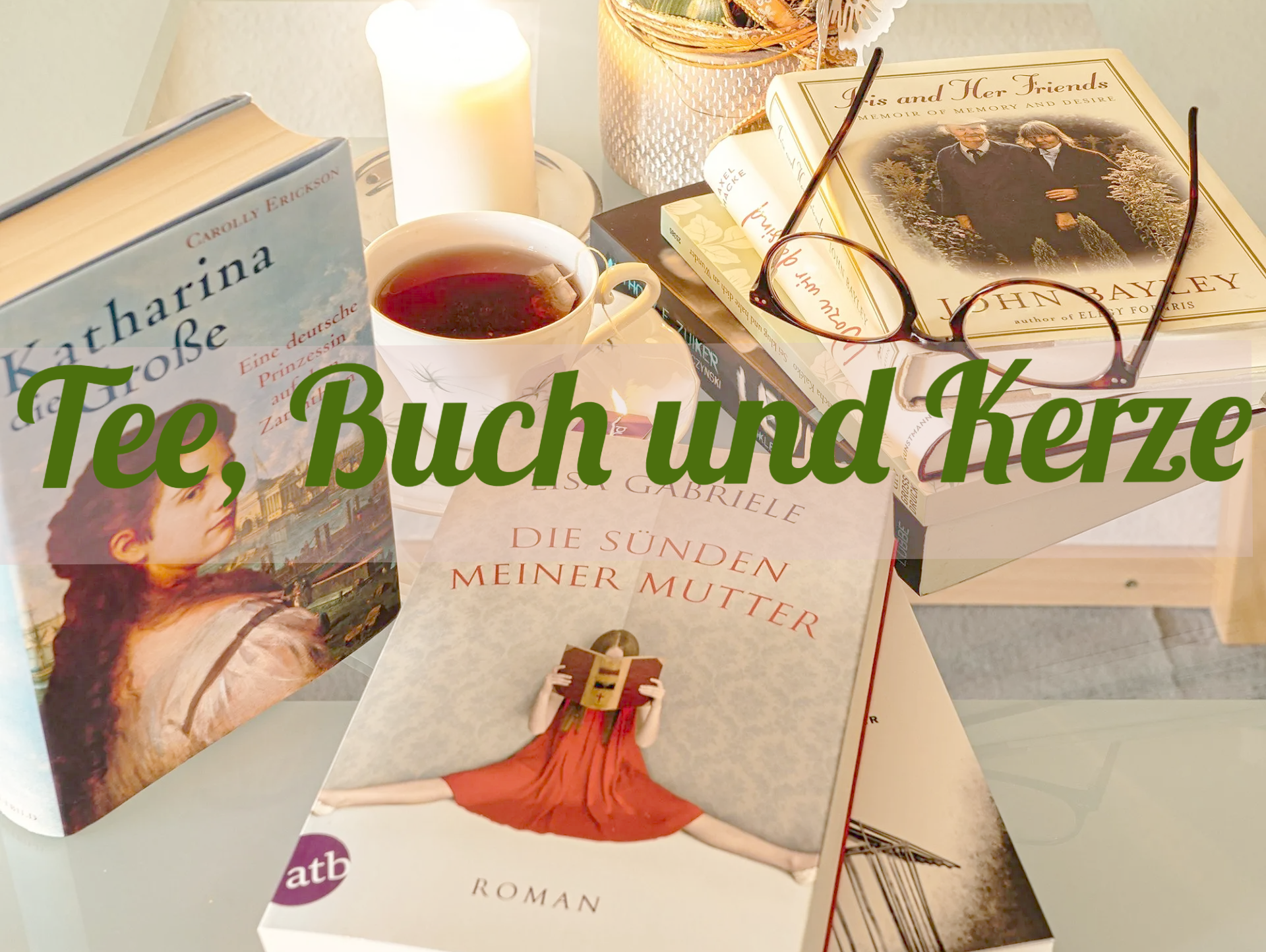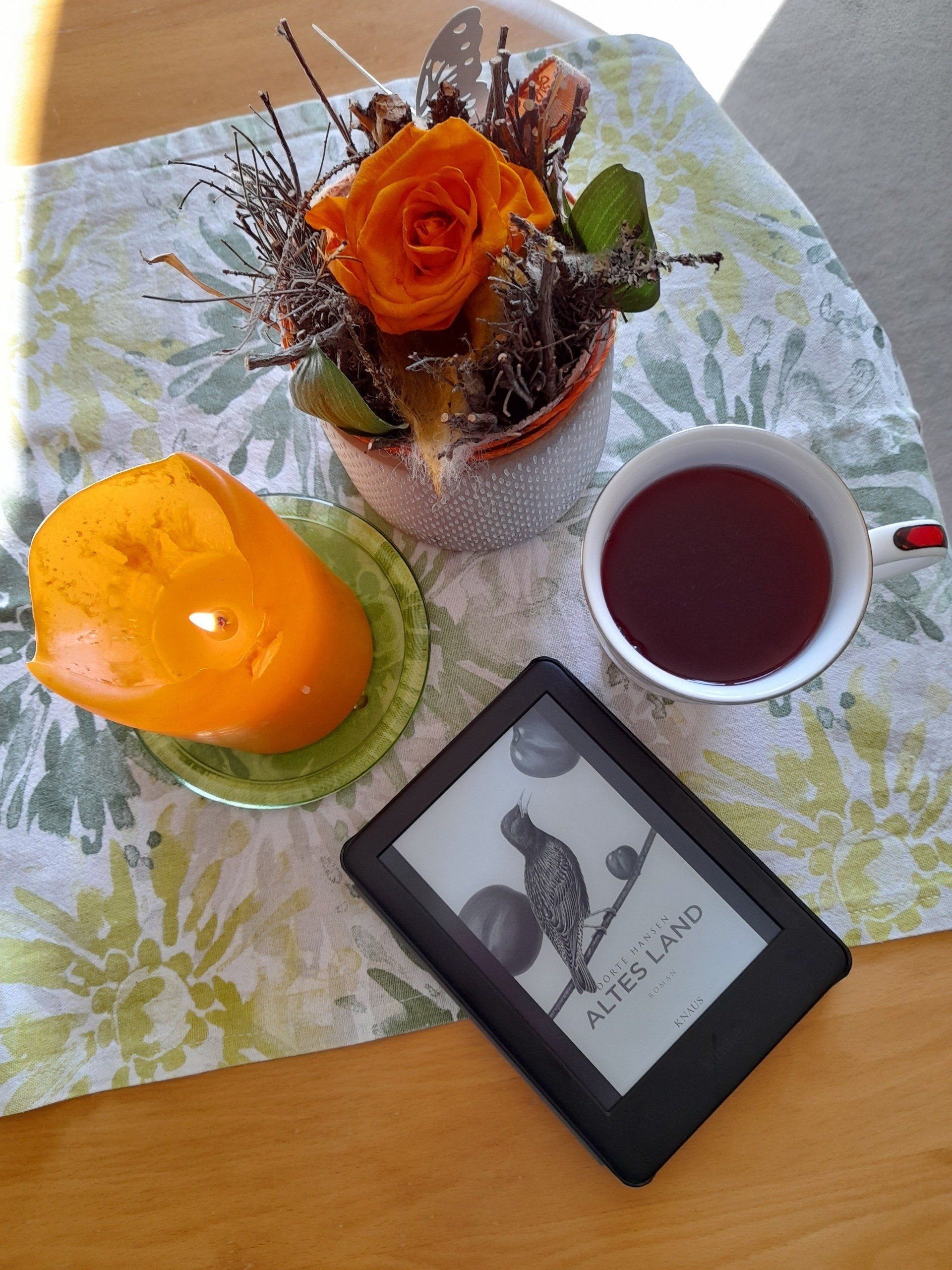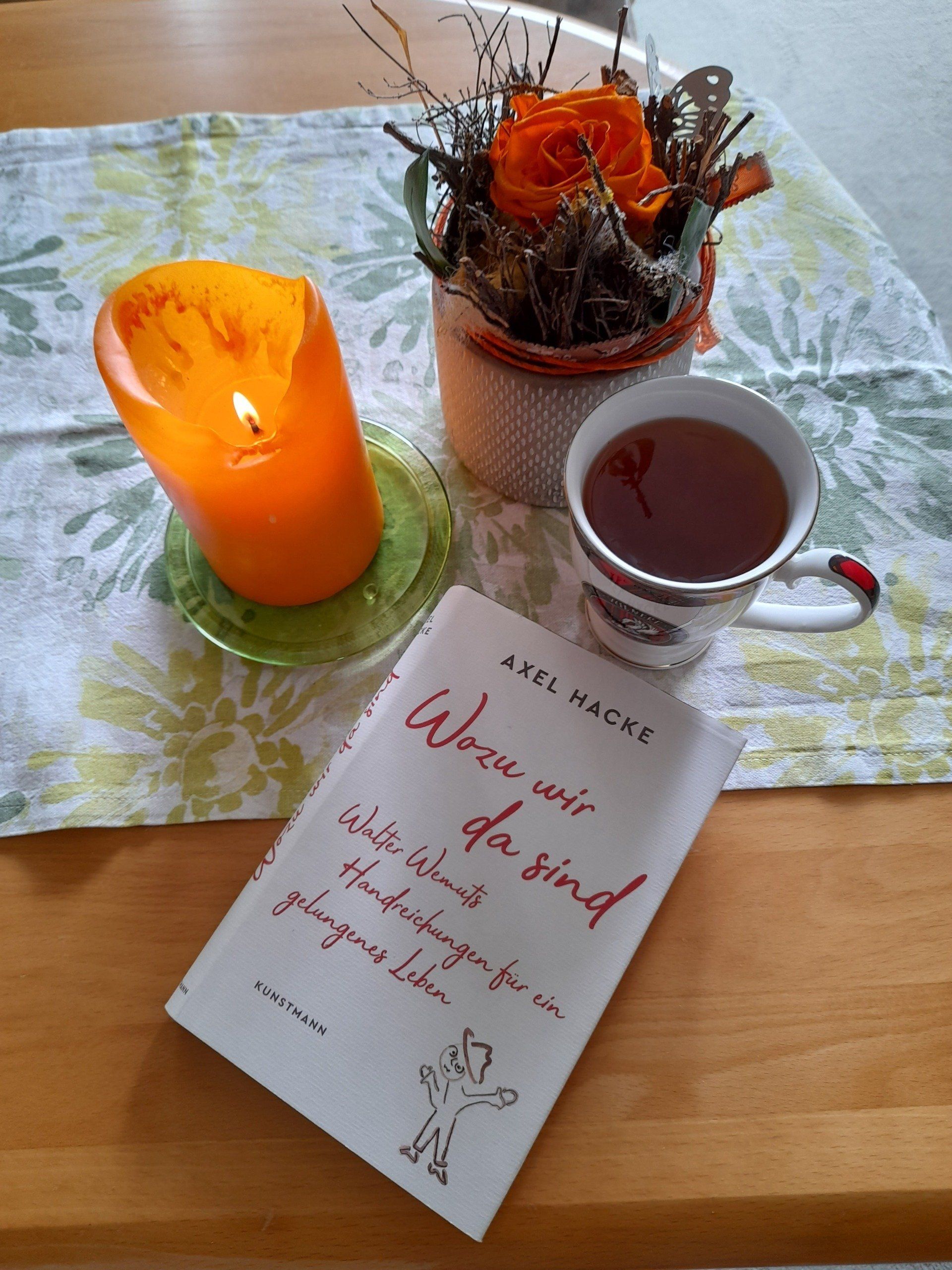Klappentext:
Das „Polackenkind“ ist die fünfjährige Vera auf dem Hof im Alten Land, wohin sie 1945 aus Ostpreußen mit ihrer Mutter geflohen ist. Ihr Leben lang fühlt sie sich fremd in dem großen, kalten Bauernhaus und kann trotzdem nicht davon lassen. Bis sechzig Jahre später plötzlich ihre Nichte Anne vor der Tür steht. Sie ist mit ihrem kleinen Sohn aus Hamburg-Ottensen geflüchtet, wo ehrgeizige Vollwert-Eltern ihre Kinder wie Preispokale durch die Straßen tragen – und wo Annes Mann eine andere liebt. Vera und Anne sind einander fremd und haben doch viel mehr gemeinsam, als sie ahnen.
Mit scharfem Blick und trockenem Witz erzählt Dörte Hansen von zwei Einzelgängerinnen, die überraschend finden, was sie nie gesucht haben: eine Familie.
Über die Autorin:
Dörte Hansen, geboren 1964 in Husum, arbeitete nach ihrem Studium der Linguistik als NDR-Redakteurin und Autorin für Hörfunk und Print. Ihr Debüt „Altes Land“ wurde 2015 zum „Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels“ gekürt und avancierte zum Jahresbestseller 2015 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Im Oktober 2018 ist ihr zweiter Roman „Mittagsstunde“ erschienen. Dörte Hansen lebt mit ihrer Familie in Nordfriesland.
Meine Meinung:
„Altes Land“ ist ein leichtes und amüsantes Buch, literarisch hervorragend geschrieben. Dabei ist die Geschichte mitunter auch ziemlich düster. Kriegsflüchtlinge aus Ostpreußen müssen in den alten Bauernhäusern im Alten Land untergebracht werden. Später sind es die Stadtflüchtlinge, die ins Alte Land ziehen. Die Kapitel wechseln sich ab in der Flüchtlingsgeschichte von damals und von heute. Die Protagonisten schleppen sich mit ihren individuellen Geistern herum. Einige kämpfen dagegen, viele finden sich damit ab. Dörte Hansen beschreibt in ihrem Buch die Unterschiede zwischen den Generationen und die Unterschiede zwischen Dorf- und Stadtbevölkerung. Sie alle prallen im Alten Land aufeinander und müssen versuchen, irgendwie mit einander umzugehen. Das gelingt nicht immer, manchmal aber doch. Dabei bedient sie sich einer Sprache, die literarisch wunderbar und liebenswert ist, aber grausame und traurige Bilder durchaus klar umreißt. Sie ist kritisch mit den Menschen und der Welt und dabei oft etwas bissig. Aber niemals unangenehm. Ich habe oft über ihren Sarkasmus geschmunzelt.
Mein Fazit:
Mir wurde das Buch unabhängig von zwei Freundinnen wärmstens empfohlen. Und ich bin froh, dieser Empfehlung gefolgt zu sein. Es ist ein wunderbares Buch, gar nicht so lang. Kauf es, lies es. Es lohnt sich!
Auszüge / Zitate aus dem Buch:
Seine Abmahnungsgespräche waren durchkomponiert, sie begannen immer leise. Gleich würde er sich kurz und heftig aufregen, molto vivace, das war noch auszuhalten, der wirklich schlimme Teil kam erst danach.
Bernd ging das ja alles tierisch an die Nieren. Die Kraft, die ihn diese Arbeit jeden Tag kostete, das machte sich nie einer klar, und jetzt noch diese Scheiße hier, die Aggressionen, das Negative, die ganzen schlechten Schwingungen. Es machte ihn krank, es brannte ihn aus, er würde wieder weinen. Den Blick leicht anheben, die Augen schließen und wie in Zeitlupe den Kopf schütteln. Grave.
Die Tränendrüse gehörte zum Konfliktgespräch wie das Jeanshemd zum Schnuppertag.
Dann kam der Tag mit all den Windeln und den Flaschen, mit Schnullerketten, Handschuhen und Mützen, die immer weg waren, mit Kinderarztterminen, Sandformen, Matschhosen, Wickeltaschen, und plötzlich waren das Mutterglück und die Dankbarkeit nicht mehr auffindbar, sie rutschten tief unter die Feuchttücherpakete, gingen unter in Babyschwimmbecken und Getreidebrei.
In Ottensen trugen die Kinder oft seltsame Kleider, Röcke und Hosen übereinander, gepunktet, gestreift, kariert, egal, rechts und links verschiedene Socken oder Handschuhe, irgendwelche Schals zu irgendwelchen Mützen irgendwie um Kopf und Hals gestopft. Oft war es das Ergebnis einer autonomen kindlichen Entscheidung am Kleiderschrank, die selbstverständlich respektiert wurde, auch wenn das Kind am Ende aussah, als wäre es nach einer Naturkatastrophe aus Spendenmitteln neu eingekleidet worden.
Anne hörte sie poltern und musste an ihre Mutter denken, die es genauso machte: das Gesicht verriegeln, kein Wort sagen, lieber die Dinge schreien lassen. Marlene konnte Gemüsesuppe kochen und es wie ein Massaker klingen lassen: Kohlköpfe zerhacken, Bohnen brechen, Möhren mit hässlichen Geräuschen die Haut herunterschrappen.
Ostern beim Vater, Pfingsten bei der Mutter, Gerechtigkeit bis in die Feiertage, es war wohl üblich heute, sich ein Kind gerecht zu teilen, sobald die Liebe sich erledigt hatte.
Geschiedene Leute, ein sauberer Schnitt, scheinbar gab es das nicht mehr, sie hingen jetzt für immer aneinander, all die Paare, die sich geirrt hatten und sich entzweien wollten, sie wollten weg und konnten nicht, sie waren mit den Köpfen festgewachsen aneinander durch die Kinder.
Dirk zum Feldes Vater hatte wohl die Nase voll gehabt von Sprossenfenstern, Reet und Fachwerk, weg mit den olen Schiet, irgendwann in den Siebzigern, als die Denkmalschützer noch nichts zu sagen hatten und nur die Alten und die Rückständigen noch in den engen, dunklen Kammern hausen wollten.
Er hatte das Haus auf Vordermann gebracht, eine breite Tür mit Glasbausteinen eingesetzt, das Dach mit Ziegeln neu gedeckt und ausgebaut mit großen Gauben, es gab sehr viele solcher Häuser in den Dörfern an der Elbe.
„Kaputtsaniert“, stöhnten die Immobilienmakler, wenn sie für diese Bausünden Käufer finden sollten, der Fortschritt sah im Nachhinein sehr hässlich aus, die meisten alten Bauern bereuten es schon längst.
Alle Töchter wussten, dass ihre Mütter auch nur Töchter waren, und alle vergaßen es.
Was hier nicht wegging, war der Bodensatz, die Resterampe. Kleine Fische, arme Schweine, schräge Vögel. Grenzdebile Hofpflasterer, Sozialphobiker wie diese Vera Eckhoff und schlichtgestrickte Bauern wie Dirk zum Felde.
Wozu wir da sind
Wozu wir da sind - Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben
von Axel Hacke
Verlag Antje Kunstmann
Klappentext:
„Ich mache das normalerweise nicht, Geburtstagsreden. Mein Metier sind Nachrufe, also, wenn die Sache gelaufen ist, dann bin ich dran. Die Zeitung hat das eingeführt, eine eigene Seite, nur für die Toten und für mich, einmal die Woche. Aber nicht nur für die berühmten Toten, auch für die ganz normalen Menschen…“
Seit dreißig Jahren schreibt Walter Wemut Nachrufe. Nun soll er die Rede zum achtzigsten Geburtstag einer Freundin halten. Thema: das gelungene Leben. Aber wann ist ein Leben gelungen? Und wer entscheidet das? Darüber denkt Wemut nach, darüber spricht er hier, in einem furiosen Monolog über das Leben, poetisch, witzig und klug.
„Ich weiß, mein Beruf kommt Ihnen seltsam vor. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist normal. Das geht allen so. Die Leute sagen oft zu mir: Ist das nicht furchtbar traurig, sich immerzu mit dem Tod zu befassen? Aber ich befasse mich nicht mit dem Tod! Mein Thema ist das Leben - nur eben dann, wenn es vorbei ist.“
Walter Wemut hat, als Autor, eine eigene Seite in der Zeitung, jeden Samstag: Die Toten der Woche. Hier veröffentlicht er Nachrufe, manchmal nur einen, manchmal fünf oder sechs, das ist allein seine Sache. Er schreibt über verstorbene Politiker und über seinen einstigen Buchhändler, über Leonard Cohen und über den toten Masseur einer Fußballmannschaft. Aber nun die Rede zum achtzigsten Geburtstag einer Freundin zu halten, das ist für ihn eine neue Herausforderung, und so gehen seine Gedanken zu den Freunden, die er hat und hatte, zu Agim, seinem Friseur, zum Zeitungshändler Kaczmarczyk und zu der Frau, die ihn grundlos auf der Straße beschimpft.
Mit Neugier und seinem an Hunderten von Schicksalen geschulten Blick beleuchtet Wemut die Lebensentwürfe, die ihm begegnet sind, zieht die Literatur zu Rate, betrachtet sein eigenes Leben – und zieht seine Schlüsse, geistreich, heiter, scharfsinnig.
Zum Autor:
Axel Hacke lebt als Schriftsteller und Kolumnist des Süddeutsche Zeitung Magazins in München. Er gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands, seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zuletzt erschien „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“.
(Verlag Antje Kunstmann 2017)
Meine Meinung:
Walter Wemut, Verfasser von Nachrufen - manchmal sogar auf fiktive Personen -, soll eine Rede zum achtzigsten Geburtstag einer Freundin halten. Für eine noch Lebende. Das fällt ihm schwer. Er soll über das gelungene Leben seiner Freundin sprechen. Und stellt sich dabei die philosophische Frage, was überhaupt ein gelungenes Leben ist. Unweigerlich kommt da die Frage auf: Gibt es auch ein ungelungenes Leben? Wemut liefert Beispiele aus seinem Leben, das von Freunden und Bekannten, aus der Literatur und der Zeitung, um diese Fragen zu klären. So entsteht ein Gedankenmonolog, philosophisch, ironisch, humorvoll und mit rasanten Themenwechseln, auf die im Laufe der Zeit aber wieder eingegangen wird, so dass sich der Gedankenkreis früher oder später wieder schließt.
Zwei junge berufstätige Frauen und Mütter, die abends zum Sport gehen, können ihre Tage komplett unterschiedlich empfinden. Die eine freut sich, weil sie etwas für sich tut, die andere empfindet das nur als ein weiteres Muss in ihrem Alltag, das ihr keinen Spaß macht und sie sich fremdgesteuert fühlen lässt. Was für die eine ein gelungenes Leben ist, ist für die andere ein nicht Gelungenes. Wemut kommt unter anderem zu dem Schluss, dass die Frage nach einem gelungenen Leben eigentlich die Frage nach dem Sinn des Lebens ist. Und den muss jeder für sich allein herausfinden.
Für Walter Wemut sind es unter anderem Freundschaften und Kontakte mit anderen Menschen. Ferner ist es ausschlaggebend für ein gelungenes Leben, wie offen wir mit anderen Menschen und deren Geschichten umgehen. Ob wir mit wildfremden Menschen ins Gespräch kommen, uns für sie Zeit nehmen, oder ob wir sie von oben herab verurteilen, allein für ihr Aussehen, ihren Lebenswandel, ihre Fehler. Für ein gelungenes Leben stehen offenbar Gutmütigkeit, Offenheit, Interesse, Zuwendung, das Hinnehmen und Vergeben, das Zuhören. Das ist sehr schwer und liegt nicht jedem. Es hat auch damit zu tun, wie wir mit den Schicksalen und Wendungen in unserem Leben umgehen. Genießt man, was man hat und vom Leben bekommt und söhnt sich mit Fehlschlägen aus? Oder suhlt man sich in seinem Selbstmitleid?
Mein Fazit:
Es ist mein erstes Buch von Axel Hacke. Ich hatte schon sehr viel Positives über ihn und seine Schriften gehört, bisher aber noch nichts von ihm gelesen. Bis eine Freundin mir dieses Buch schenkte. Axel Hacke schreibt intelligent und literarisch perfekt. Dennoch ist das Buch lehr leicht zu lesen und äußerst unterhaltsam. Ich habe viel geschmunzelt, viel über das nachgedacht, was er so schreibt und viele Erkenntnisse für mich getroffen.
Die Bücher von Axel Hacke werden ab sofort Einzug in meinen Bücherschrank halten und ich freue mich schon auf das nächste Lesevergnügen mit ihm.
Auszüge aus dem Buch:
Aber in der großen Mehrzahl besteht die Menschheit nun mal aus solchen, über die nicht groß was zu erzählen ist. So scheint es. Und genau das ist das Interessante. Weil es nämlich – meine Erfahrung – immer etwas sehr Interessantes zu erzählen gibt. Über praktisch jeden Menschen. Auch über den Masseur.
Man muss es nur herausfinden. Man muss es wissen wollen.
Wir reden immer von den großen Gefühlen, von Liebe und Tod, aber ich denke, man müsste auch mal von diesen kleinen Gefühlen sprechen, vom emotionalen Alltag, von diesen Leuten, denen man begegnet, wie sich Billardkugeln treffen, manchmal knallen sie voll aufeinander, bisweilen touchieren sie sich nur seitlich, dann wieder verpassen sie sich, aber nie bleibt das ohne Wirkung für das ganze Spiel.
Ich sage Ihnen Folgendes: Es hat sich bei uns wieder so ein Klassendenken etabliert, ein ganz neues, aber doch sehr altes, das es lange nicht gab. Man betrachtet Boten, Straßenkehrer, Hauswarte von oben herab. Man fühlt sich gerne als was Besseres, so wie in jenen Zeiten, als die feinen Herrschaften erwarteten, dass man ihnen Platz machte auf dem Bürgersteig. So ist das heute wieder.
Und für verfumfeien steht hier noch als Zitat aus Ernst Moritz Arndts Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn Heinrich Karl Friedrich von Stein (Mann, das waren noch Buchtitel!, fast so lang wie ein Tweet, die meisten Leser wären heute schon nach der Lektüre des Titels erschöpft).
Kennen Sie, nebenbei gesagt, eigentlich diese Art von Mensch, die plötzlich so einen Sprechdurchfall bekommt, und Sie kommen mit keinem Wort dazwischen, da ist einfach nirgends eine Lücke, in die Sie mit einem Auf Wiedersehen oder Ich müsste dann mal … hineinstoßen könnten?
Gelungenes Leben.
Was stört mich andererseits an diesen Worten?
Erstens, aber das hatten wir irgendwie schon: dass es heute so banal klingt, nach Lebensberatungs-Seiten in einer bunten Illustrierten, nach den Schwaflern, die von ihren Glücksmomenten erzählen, dieses Glücksgesülze. Nach Oberflächen putzen.
Ich will Sie jetzt mal etwas fragen: Was halten Sie von Flucht? Aus dem Alltag, meine ich, aus dem täglichen Leben?
Sie müssen wissen, dass ich das liebe, zu manchen Zeiten jedenfalls, meistens im Herbst oder im Winter. Die Dinge sind dann nicht anders zu ertragen als durch Vergessen, Sichverabschieden in eine andere Wirklichkeit, also in Bücher, ja, aber nur die dicken Dinger, die nicht so schnell aufhören. Auch derentwegen bin ich mal Bibliothek geworden.
Natürlich erkannte ich ihn nicht wieder.
Ich erkenne Leute eigentlich nie wieder, jedenfalls nicht, wenn ich sie dreißig Jahre lang nicht gesehen habe. Über manche Mienen fährt die Zeit wie ein Bulldozer, anderen Menschen hängt sie wie Blei an den Gesichtszügen, vermutlich ist das bei mir nicht anders. Aber mich sehe ich ja seit Jahrzehnten täglich, da fällt einem das nicht so auf. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber wenn Sie jemandem dreißig Jahre lang nicht begegnet sind, dann haben Sie noch sein Bild von damals im Kopf. Nun aber sehen Sie das neue, das aktuelle. Das ist wie ein Zeitsprung, in Millisekunden altert dieser Mensch um dreißig Jahre, gruselig.
Sollte es nicht, das will ich sagen, ein paar Leute im Leben jedes Menschen geben, um die er sich bemüht hat, denen er mit seinem Interesse zu Leibe gerückt ist und die er versucht hat, zu verstehen? Wahrscheinlich kann man das nicht bei sehr vielen tun, wenn man sich nicht überfordern will.
Aber bei einigen müsste man es versuchen.
Man muss es versuchen, wissen Sie. Weil, wenn man es nicht getan hat … Man ist dann irgendwie nicht dahin vorgedrungen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
Ich bin – das habe ich Ihnen auch schon mal gesagt – im Laufe meiner Lebensjahrzehnte zu der Ansicht gekommen, dass man möglichst wenig urteilen und möglichst viel fragen sollte. Man sollte neugierig sein, bleiben, werden.
Sind Freunde nicht die Leute, die Dinge von dir wissen, die alle anderen nicht wissen? Ist das nicht die Art Definition? Und mit denen du über Dinge reden kannst, über die du mit anderen nicht sprichst? Nicht sprechen kannst? Nicht sprechen willst? Ist nicht auch Freundschaft, wie die Zufriedenheit, etwas Stilles, etwas, was nicht behauptet werden muss und nicht behauptet werden sollte, was mit den Jahren wächst, und an dem man arbeiten muss? Etwas Seltenes auch –
Worum geht es bei einer solchen Suche anders als um den Sinn des Lebens, um das, worüber wir vorhin schon mal geredet haben: wozu wir da sind. Es bringt den Menschen ja eigentlich nicht weiter, wenn er nach diesem Sinn einfach nur fragt und von irgendwoher eine Antwort erwartet. Die wird nicht kommen. Denn er selbst ist es doch, der seinem Leben einen Sinn geben muss.